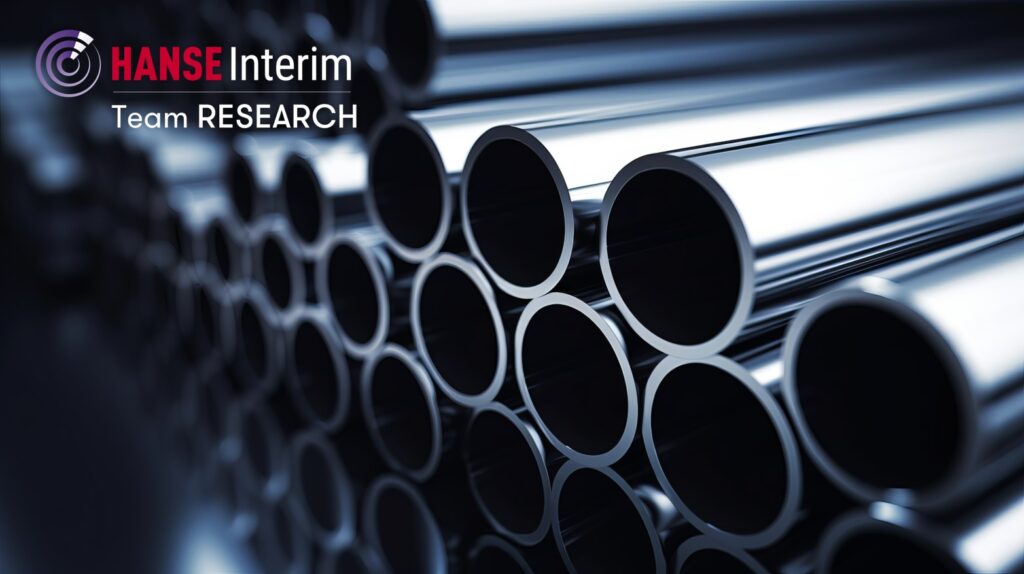Der Zustand
Kleider machen Leute.
Doch wie verhält sich der deutsche Modemarkt in der Coronakrise?
Seit 2015 entwickelt sich der deutsche Textileinzelhandel rückläufig. Die sinkende Bedeutung des stationären Einzelhandels, Kostensteigerungen durch höhere Produktionskosten in der vorgelagerten Branche der Wertschöpfungskette, ein intensivierter Preiswettbewerb mit Textildiscountern und die wachsende externe Konkurrenz durch den reinen Online- und Versandhandel lassen die Umsätze in diesem Segment einbrechen.
Verschärft wurde die Situation dann noch durch die Pandemie:
Zwangsschließungen, Ausgangsbeschränkungen, Home-Office und Kontaktsperre.
Genau dieses Dilemma haben die deutschen Modehersteller im ersten Halbjahr 2020 deutlich zu spüren bekommen. Zudem war Shopping in wirtschaftlich unsicheren Zeiten für viele Deutsche undenkbar, denn die Verbraucher hielten ihr Geld aufgrund steigender Kurzarbeit, drohender Arbeitslosigkeit und der befürchteten Rezession zusammen.
Das veränderte sparsame Konsumverhalten sowie abgesagte Veranstaltungen sorgten im deutschen stationären Modemarkt in der Coronakrise für ein Umsatzminus von 20,3 Prozent. Besonders betroffen waren die Hersteller von Business- und anlassbezogener Kleidung, vorwiegend im Herrensegment. Verwunderlich ist dies nicht, denn Home-Office und der neue Smoking verhalten sich konträr zueinander.
Nachgeholt wurden diese Käufe nicht und die anschließende Maskenpflicht machte es den Ladengeschäften nicht einfacher – lange Shoppingtouren waren für viele Deutsche durch das Tragen der Maske reizlos.
Leere Innenstädte bedeuteten leere Filialen und auch folglich leere Kassen – die Auswirkungen der Pandemie machten auch vor großen Modekonzernen keinen Halt. Rückläufige, vielmehr fehlende Besucherfrequenzen gepaart mit gestiegenen Mieten für essenzielle hochwertige Innenstadtlagen bedeuteten eine hohe Belastung für viele Ladenbesitzer. So will z.B. Esprit rund die Hälfte seiner Filialen in Deutschland schließen. Um sich vor Forderungen zu schützen, beantragte die bekannte Modemarke bereits Ende 2019 ein Schutzschirmverfahren für mehrere Tochtergesellschaften.
Das Corona-Virus bedeutete für den Einen Sackgasse – und für den Anderen eine Chance. Während der stationäre Handel noch immer mit den Auswirkungen der Coronakrise zu kämpfen hat, stieg der Onlineanteil auf 35%. So ging z.B. der Internet-Pure-Player Zalando laut eigenen Angaben besser aus der Krise heraus, als hinein.

Einige Modeunternehmen sahen so auch eine Chance in der Krise: wo vorher wochenlange Diskussionen um Entscheidungsfindungen herrschten, wurden plötzlich Prozesse beschleunigt, um auf die Auswirkungen des Virus schnell reagieren zu können. Jene Modefirmen, die bereits vor COVID-19 mit Umsätzen und mangelhaften finanziellen Rücklagen zu kämpfen hatten, stehen nun vor einer gewaltigen Herausforderung.
Um überhaupt Umsatz während des Lockdowns generieren zu können, blieb daher für viele Unternehmen im Modemarkt in der Coronakrise nur der Abverkauf über digitale Kanäle einhergehend mit der Überarbeitung und Investition in die notwendige IT, um Kundennähe zu schaffen. Wer vorher ausschließlich auf das Filialnetz setzte, hatte nun zu Corona-Zeiten kaum eine andere Wahl als den digitalen Weg einzuschlagen und einen ergänzenden Web-Shop zu betreiben. Sicher ist, dass die Ergänzung des Filialnetzes um einen eigenen Online-Shop mittelfristig notwendig ist, um das Umsatzniveau zu halten bzw. auszubauen. Ohne diesen zusätzlichen Vertriebskanal werden die Filialen sukzessive Umsatz verlieren, da der Online-Anteil im Modeeinzelhandel durch das digitale Konsumentenverhalten steigen wird.
Die Schlussfolgerung
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor liegt hier in der intelligenten Verknüpfung von stationärem und Online-Geschäft inklusive Kundenbindungsprogramme. Damit sich kleinere bzw. höherpreisige Bekleidungseinzelhändler (weiterhin) behaupten können, müssen sie ein klares Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten – z.B. ein überzeugendes Store Concept und eine positive Customer Experience.
In 2021 dürften die Konsumausgaben für Bekleidung und Schuhe wieder signifikant steigen, wovon die Branchenakteure profitieren – so lässt aktuell auch das kürzlich erst beschlossene Termin-Shopping die stationären Händler wieder etwas aufatmen.
Das Vorkrisenniveau von 2019 soll laut Prognosen allerdings auch in den Folgejahren nicht wieder erreicht werden. Demnach dient die Corona-Pandemie als Katalysator für die Entwicklung des Onlinehandels. Für den Textileinzelhandel wird zukünftig jedoch eine Stagnation erwartet.
Wann lesen wir uns wieder?
Unser neuer Blogbeitrag erscheint in zwei Wochen,
am Donnerstag, den 08.04.2021.
Worum es hier gehen wird?
Um unterschiedliche steuerliche Maßnahmen des Gesetzgebers zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen für Unternehmen. Wir von HANSE Interim wollen Sie mit Unterstützung unseres Kooperationspartners Warth & Klein Grant Thornton im Rahmen der Rubrik AKTUELL unseres Blogs informieren.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr HANSE Interim-Team
Andreas Lau und Christian Heuermann
Geschäftsführung
Quellen: HMC Researchabteilung, Bundesagentur für Arbeit, Handelsblatt, HDE, IBIS World, McKinsey, PwC, statista